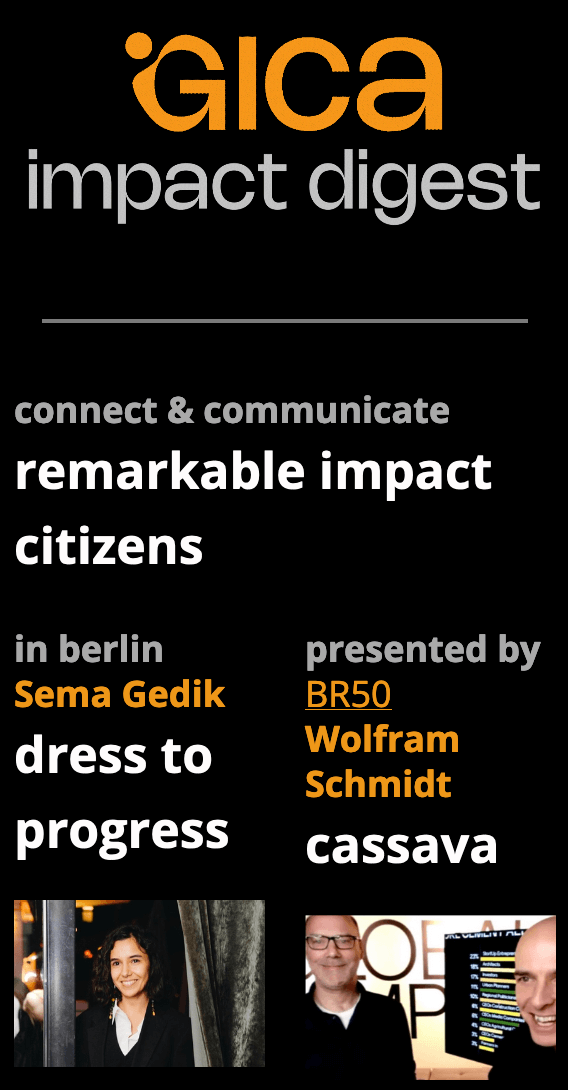Bricht unsere Welt auseinander, oder gibt es noch Hoffnung? Und kann die UNO diese Hoffnung sein? Im sanften Licht des Humboldt Kaffee Manufakturentwickelt sich ein außergewöhnliches Gespräch, das den globalen Herausforderungen unserer Zeit eine persönliche Note verleiht. Dr. Ekkehard Griep, Vorsitzender des Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationenund Chris Melzer, Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) in Deutschland, teilen ihre Erfahrungen aus den Krisengebieten der Welt. Was eine akademische Diskussion hätte sein können, wird durch die Erfahrungen dieser beiden Experten zu einem fesselnden Bericht über menschliche Schicksale und institutionelle Grenzen.
122 Millionen Vertriebene - ein trauriger Rekord
"Derzeit gibt es mehr als 120 Millionen Vertriebene auf der Welt. erklärt Melzer mit ruhiger Stimme. "Ein historischer Höhepunkt, ein tragischer Rekord. So etwas hat es noch nie gegeben." Seine Worte hängen schwer im Raum. Zum Vergleich: Deutschland hat rund 83 Millionen Einwohner. Stellen Sie sich vor, die gesamte deutsche Bevölkerung plus fast 40 Millionen weitere Menschen wären gezwungen, ihre Heimat zu verlassen.
Weiße Zelte und große Herausforderungen
Aber es gibt auch einen kleinen positiven Aspekt in diesem Drama: Jeder kennt das Bild der weißen UNHCR-Zelte in den Flüchtlingslagern aus den Nachrichten. Doch Melzer räumt mit einem Missverständnis auf: "Nur der kleinste Teil der Flüchtlinge, nicht einmal 10 Prozent, lebt tatsächlich in Lagern. Die meisten leben Seite an Seite mit Einheimischen." Das bedeutet, dass die Mehrheit der Vertriebenen weltweit (freiwillige) Hilfe von anderen Personen und nicht nur von Institutionen erhält.
Die Arbeit des UNHCR besteht aus zwei Hauptkomponenten: dem "humanitären Arm", der die Grundversorgung sicherstellt - Unterkunft, sauberes Wasser, Bildung für Kinder, medizinische Versorgung - und dem "politischen Arm", der sich für die Rechte der Flüchtlinge einsetzt. "Wir wurden einmal die Hüter der Genfer Flüchtlingskonvention genannt. sagt Melzer.

Ständig unter finanziellem Druck
Die Herausforderungen sind enorm, und die Ressourcen sind begrenzt. "Wir waren immer unterfinanziert, zumindest in den letzten 30 oder 40 Jahren". räumt Melzer ein. Mit einem Jahresbudget von rund 5,2 Milliarden Dollar mag das UNHCR auf den ersten Blick gut finanziert sein. Aber angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen reicht das bei weitem nicht aus.
"Als ich beim UNHCR anfing, gab es etwa 60 Millionen Vertriebene. Jetzt sind es 122 Millionen". erinnert sich Melzer. "Das war vor acht Jahren." Dieser dramatische Anstieg ist vor allem auf die Krisen in Syrien, Afghanistan und der Ukraine zurückzuführen.
"Und jetzt im Sudan: 13 Millionen Menschen sind auf der Flucht, die meisten von ihnen innerhalb des Landes.
Und nun beginnen viele Systeme zusammenzubrechen. Die Trump-Regierung hat erhebliche Mittel, die zuvor für internationale Zwecke bereitgestellt wurden, gestoppt.

Die Finanzierungskrise und ihre tödlichen Folgen
Es zeichnet sich eine dramatische Unterfinanzierung der UN-Organisationen ab. "Bis vor kurzem finanzierten die USA 2,1 Milliarden Dollar des UNHCR-Budgets von 5,2 Milliarden Dollar. erklärt Melzer. "Und dieses Jahr bekommen wir vielleicht gar nichts."
Die Folgen sind schmerzhaft direkt: "Das kostet buchstäblich Leben. Menschen sterben, weil sie nicht mit Nahrung versorgt werden können, weil sie nicht geimpft werden, weil sie kein Dach über dem Kopf haben."
Aufgrund der unberechenbaren US-Politik, des radikalen Einfrierens der Mittel und der geplanten Schließung von USAID werden Millionen von Menschen dem Elend überlassen - im vollen Bewusstsein der wohlhabenden Nationen.
Doch ohne die UNO wäre die Situation noch viel schlimmer.

Blauhelme: Zwischen Ohnmacht und Erfolgsgeschichten
Während Melzer aus einer humanitären Perspektive spricht, beleuchtet Dr. Griep die Rolle der UN-Friedensmissionen. Bei den so genannten "Blauhelmen" handelt es sich um multidimensionale Missionen, die nicht nur aus militärischen Einheiten, sondern auch aus Polizeikräften und zivilen Experten für Menschenrechtsbeobachtung, Regierungsberatung und anderen Bereichen bestehen.
"Friedensmissionen sind im Wesentlichen dazu da, Zeit zu gewinnen". Griep erklärt. "Sie werden niemals in der Lage sein, einen Konflikt zu lösen. Das ist die Aufgabe der lokalen Akteure".
UN-Missionen sollen deeskalierend wirken, für Stabilität sorgen und Raum für den eigentlichen Friedensprozess schaffen.
Doch wie wirksam sind diese Missionen? "Das hängt ganz vom Mandat ab". sagt Griep. Einige Missionen haben das Recht, Gewalt anzuwenden - so genannte Kapitel-Sieben-Mandate auf der Grundlage der UN-Charta. Andere sind reine Beobachtermissionen.
Es gibt Erfolgsgeschichten, wie z. B. Liberia, wo eine UN-Mission dazu beigetragen hat, das Land zu stabilisieren und eine funktionierende Polizei nach einem 14-jährigen Bürgerkrieg aufzubauen. "Am Ende eines 15-jährigen Prozesses (im Jahr 2018) war die ursprünglich 15.000 Mann starke UN-Mission auf 800, dann 400, schließlich nur noch 20 und schließlich fünf geschrumpft. Griep berichtet. "Die Mission hat sich selbst überflüssig gemacht. Und das ist im Grunde das Ziel der UN-Friedenssicherung: sich selbst überflüssig zu machen - wenn nationale Akteure und Institutionen in der Lage sind, die Verantwortung zu übernehmen."
Ähnliche Erfolge gab es in Côte d'Ivoire und Mosambik. Aber es gab auch Misserfolge, wie 1994 in Ruanda, als die UN-Mission während des Völkermords vom Sicherheitsrat abgezogen wurde, oder in Mali, wo die Friedenstruppen kürzlich auf Druck der Regierung abziehen mussten - mit verheerenden Folgen für die Sicherheit.

Wenn der Schutz versagt: Der Fall Sudan
Der Sudan ist derzeit die größte humanitäre Katastrophe der Welt, wie Melzer betont: "13 Millionen Menschen sind auf der Flucht, die meisten von ihnen innerhalb des Landes. 25 Millionen Menschen benötigen dringend humanitäre Hilfe". Rund 3,5 Millionen sudanesische Flüchtlinge befinden sich in den Nachbarländern, vor allem im Tschad, einem der ärmsten Länder der Welt mit einem Durchschnittseinkommen von nur $600 pro Jahr.
Diese Zahlen verdeutlichen ein Paradoxon in der weltweiten Flüchtlingskrise: Oft sind es nicht die reichen Länder Europas oder Nordamerikas, die die meisten Flüchtlinge aufnehmen, sondern die ärmsten Nachbarländer, die kaum genug Ressourcen für ihre eigene Bevölkerung haben.
Zeichen der Hoffnung: 1,2 Millionen Rückkehrer
Trotz des düsteren Gesamtbildes gibt es auch Hoffnungsschimmer. "Noch eine Zahl: 1,2 Millionen - so viele Rückkehrer gab es letztes Jahr". berichtet Melzer. "Das ist winzig im Vergleich zu 122 Millionen. Aber es sind 1,2 Millionen Menschen, die nach Hause gehen könnten. Es ist möglich. Diese Wege existieren."
Diese Rückkehrer sind das eigentliche Ziel der Flüchtlingshilfe. Letztlich geht es nicht um den Bau von Lagern, sondern darum, den Menschen zu helfen, nach Hause zurückzukehren oder sich anderswo zu integrieren.
Melzer erzählt eine bewegende Anekdote: Vor dreißig Jahren traf sein ehemaliger Chef in einem Flüchtlingslager an der Grenze zu Mosambik Menschen, die sagten, "Wir gehen jetzt nach Hause." Drei Viertel von ihnen wurden im Lager geboren und hatten Mosambik noch nie gesehen. "Trotzdem sagten sie: 'Wir gehen jetzt nach Hause.' Es scheint ein Heimat-Gen in uns zu geben - der Drang, an einen Ort zurückzukehren, den wir Heimat nennen."
Die Zivilgesellschaft als Leuchtturm der Hoffnung
Wenn Staaten und internationale Organisationen an ihre Grenzen stoßen - wer kann dann noch helfen? Die Antwort liegt in der Zivilgesellschaft, in den Netzwerke von engagierten Bürgern, die dort einspringen, wo offizielle Strukturen versagen.
Für beide Experten ist klar: Die Krise ist zu groß, als dass ein einzelner Akteur sie bewältigen könnte.
"Wir können nicht annähernd so viel tun, wie wir wollen". räumt Melzer ein. Aber genau hier kann die Zivilgesellschaft wirksam werden.
Filippo Grandi, der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, hat es vor dem Sicherheitsrat unverblümt gesagt: "Wir müssen einfach wieder lernen, wie man Frieden schließt. Offenbar haben wir es in den letzten 15 Jahren verlernt."

Vom Kaffeeklatsch zur Aktion
Das Gespräch in der Humboldt-Kaffeemanufaktur ist vorbei, aber die Herausforderungen bleiben bestehen. Die Frage ist nicht mehr, ob wir helfen sollten, sondern wie jeder von uns dazu beitragen kann, das Leid zu lindern und die Ursachen der Vertreibung zu bekämpfen.
Während staatliche Strukturen und internationale Organisationen oft langsam und träge handeln, können zivilgesellschaftliche Netzwerke schnell und direkt reagieren. Von lokalen Flüchtlingsinitiativen über Fundraising bis hin zu politischer Lobbyarbeit - es gibt viele Möglichkeiten zu helfen.
Die Botschaft des Abends ist klar: Wenn Staaten und Institutionen schwächeln oder versagen, muss die Zivilgesellschaft einspringen. Nicht als Ersatz für staatliches Handeln, sondern als notwendige Ergänzung.
Ein Aufruf zum Handeln
Anstatt bei der nächsten Grillparty am Wochenende über den Zustand der Welt zu lamentieren, sollten Sie mit Freunden überlegen, wie Sie etwas verändern können.
Unterstützen Sie Initiativen für Flüchtlinge. Investieren Sie Zeit, um direkt oder indirekt zu helfen, Spenden zu sammeln oder Lobbyarbeit zu unterstützen - indem Sie faktenbasierte Informationen in den sozialen Medien teilen, anstatt Vorurteile zu verstärken.
Die Vereinten Nationen mögen zwischen Macht und Ohnmacht schwanken, aber wir selbst haben die Macht zu handeln. Jeder von uns kann Teil des globalen Netzwerks sein, das eingreift, wenn Institutionen an ihre Grenzen stoßen.
In einer Welt mit 122 Millionen Vertriebenen mag der Beitrag des Einzelnen gering erscheinen. Aber wie Chris Melzer betont: Es ist weit mehr als nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist ein notwendiger Teil der Lösung in einer Zeit, in der wir alle neu lernen müssen, wie man Frieden schafft - auf globaler und persönlicher Ebene.
Möglichkeiten zum Mitmachen:
- Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen
- UNO-Flüchtlingshilfe (Deutscher Partner des UNHCR)
Chris auf LinkedIn? Hier!